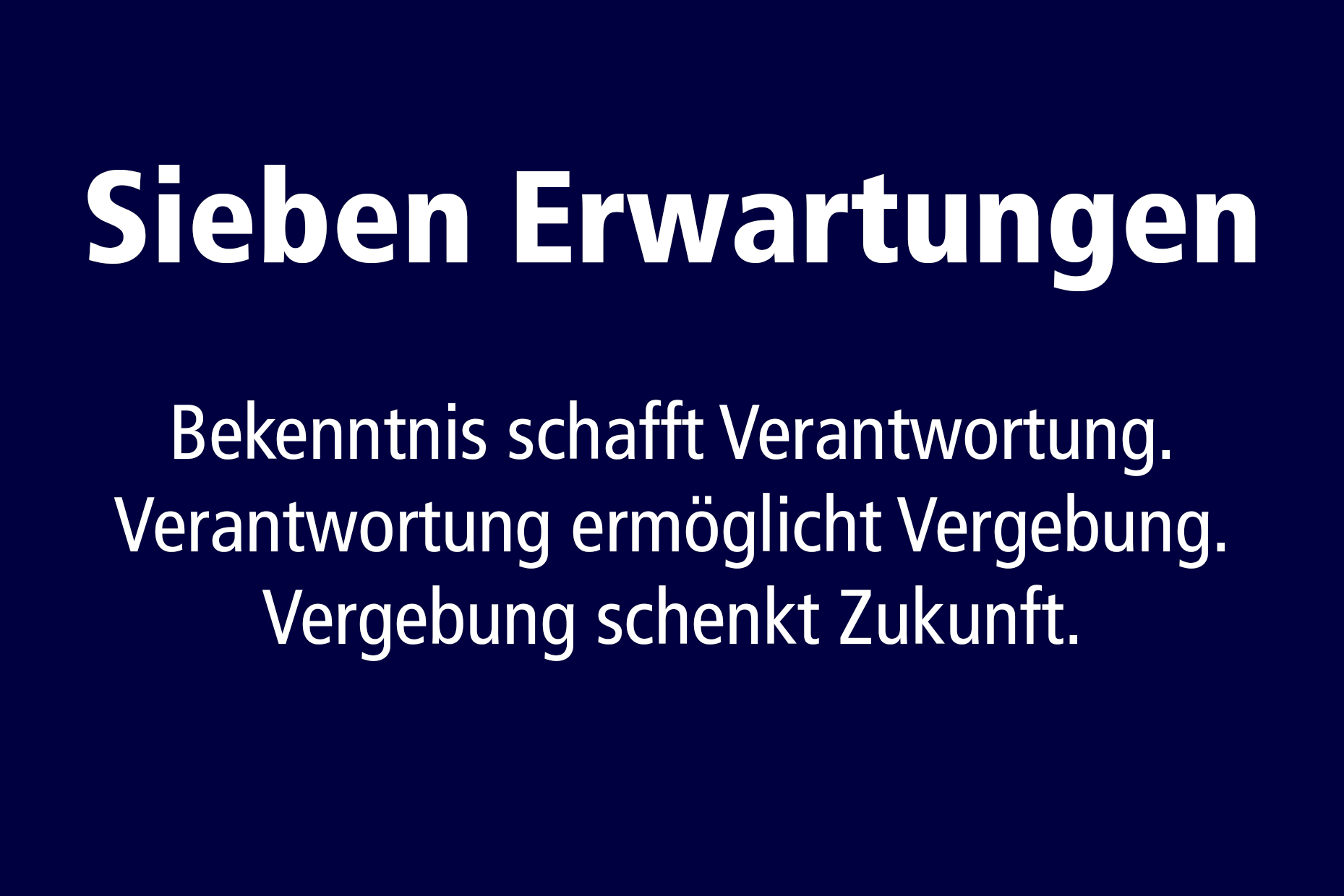
Das Positionspapier „Sieben Erwartungen“ wendet sich an katholische wie evangelische Kirchenmitglieder in Sachsen und ist ein Ergebnis des ökumenischen Arbeitskreises „Postkoloniale Perspektiven in der kirchlichen Bildungsarbeit“, in der engagierte Menschen aus der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens sowie dem Bistum Dresden-Meißen seit gut zwei Jahren zusammenarbeiten.
Drei Jahre haben wir uns von 2021 bis 2023 mit dem Thema „glaubwürdig? Mission postkolonial“ befasst. Es waren drei spannende und intensive Jahre mit schmerzhaften aber wertvollen Erkenntnissen. Was bleibt? In der 2021 veröffentlichten Thesenreihe zum Jahresthema „glaubwürdig? Mission postkolonial” erklärten wir, „Beiträge zur Überwindung vorhandener kolonialer Strukturen und Haltungen“ leisten zu wollen. Dieses Ziel ist mit dem Jahresthema keineswegs beendet. Neben der Fortsetzung unserer entwicklungspolitischen Bildungs- und Advocacyarbeit ist ein konkretes Ergebnis die Gründung des Ökumenischen Arbeitskreises „Postkoloniale Perspektiven in der kirchlichen Bildungsarbeit“ im November 2022. Im Nachgang eines Netzwerktreffens der Initiative „Sachsen postkolonial“ war die Idee entstanden, die Bemühungen um eine verstärkte postkoloniale Perspektive in der Kirche ökumenisch voranzutreiben. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche sind heute gefordert, sich mit ihrer Geschichte und der damit verbundenen Ambivalenz auseinanderzusetzen. Auf Initiative des Leipziger Missionswerkes und der Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ) wurden Akteurinnen und Akteure aus der kirchlichen Bildungsarbeit in Sachsen eingeladen, das Globale Lernen in postkolonialer Perspektive, das heißt unter Berücksichtigung des kolonialen Erbes sowie der auch heute noch in der kirchlichen Partnerschaftsarbeit teilweise stattfindenden Fortsetzungen kolonialer Strukturen, in ihren jeweiligen Arbeitszusammenhängen zu stärken. Gemeinsam diskutieren wir unter anderem über Begrifflichkeiten, beraten über Zugangswege zu einzelnen Zielgruppen, identifizieren Inhalte von Veranstaltungen mit und in den Gemeinden und tauschen uns über gruppengerechte Methoden der Vermittlungs- und Bildungsarbeit aus.
Ein weiteres Thema, das uns weiter beschäftigen wird, ist der bestehende Rassismus in unserer Gesellschaft. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte hat uns schmerzlich bewusst gemacht, wie rassistisch die Haltung der Missionare und Missionarinnen war und wie prägend der Einfluss der Mission, vor allem auch mit den verschiedenen Publikationen, auf das Menschenbild der damaligen Zeit war. Bis heute stecken rassistische Stereotype tief in uns drin. Das müssen auch die Freiwilligen aus unseren Partnerkirchen leider immer wieder erfahren. Ihre rassistischen Alltagserfahrungen sind erschreckend. Dass überhaupt darüber nachgedacht werden muss, in welche Regionen Mitteldeutschlands wir Freiwillige schicken können, ist auch ein koloniales Erbe, das es aufzuarbeiten gilt. Wir freuen uns, dass unsere Online-Werkstatt eine Fortsetzung durch die Plattform "Kirche und Rassismus" der sächsischen Landeskirche unter dem Titel "Lasst uns darüber reden" findet: (fast) jeden letzten Donnerstag im Monat, 18 Uhr.
Eine wichtige Lehre der drei Jahre ist, wie notwendig es ist, die Fotos, Bücher und Berichte der Mitarbeitenden aus der Kolonialzeit auch den Menschen in unseren Partnerkirchen zugänglich zu machen. Das bedeutet, sie zu digitalisieren, zu übersetzen und online zu veröffentlichen. Das koloniale Erbe der Bibliotheken und Archive rückt immer mehr in den Fokus. Bislang ging es vordergründig um eine Aufarbeitung der ethnologischen Sammlungen. Das schriftliche Erbe ist für unsere tansanischen Partner jedoch ungleich relevanter, weil es darin um sie selbst, um ihre Kultur und Geschichte geht. Hier sehen wir einen zentralen Punkt für einen glaubwürdigen Umgang mit unserer gemeinsamen Vergangenheit.
Eine Lernerfahrung aus der Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe ist: Es stehen nicht mehr länger unsere Perspektiven im Vordergrund. Sich gegenseitig wahrnehmen, sich zu Wort kommen lassen, andere Sichtweisen aushalten, sich zu helfen, wo es nötig und gewollt ist – darum geht es bei einer guten Partnerschaft, auf der ganz persönlichen genauso wie auf der weltkirchlichen Ebene.
Wollen Sie mehr wissen, über die Rolle der Leipziger Mission in der Kolonialzeit? Dann folgen Sie bitte diesem Link.
Sie möchten wissen, wie frühere Generationen der Leipziger Mission über den Kolonialismus gedacht haben? Lesen Sie hier Aussagen von Direktor Carl Paul.

Antje Lanzendorf hat an der Universität Leipzig Politikwissenschaft, Kommunikations- und Medienwissenschaft sowie Amerikanistik studiert und im Jahr 2005 ihr Studium mit einem Magisterabschluss beendet.
Schon während ihres Studiums war sie freie Mitarbeiterin der "Freien Presse", nahm an internationalen Workcamps teil und leistete verschiedene Praktika in entwicklungspolitischen Organisationen. Als DAAD-Stipendiatin arbeitete sie ein Semester für Probe International in Toronto/Kanada.
Antje Lanzendorf engagiert sich auch heute ehremamtlich für entwicklungspolitische Belange. Sie ist Mitglied im Vorstand des Entwicklungspolitischen Netzwerkes Sachsen.
Sendung "Wortwechsel" im Deutschlandfunk Kultur vom 18.12.2020, Direktor Ravinder Salooja u.a. im Gespräch zu kirchlicher Kolonialgeschichte
Vortrag "Mission - und wie sie sich überlebte" am 21.7.2021 in der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg - online zum nachhören.
Das könnte auch andere interessieren ...
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk Leipzig e.V.
Paul-List-Straße 19, 04103 Leipzig
Telefon: 0049 341 9940600
Telefax: 0049 341 9940690
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk Leipzig e.V. | Paul-List-Straße 19 | 04103 Leipzig | Telefon: 0049 341 9940600 | Fax: 0049 341 9940690
Vertreten durch: Direktorin Annette von Oltersdorff-Kalettka | Registernummer im Vereinsregister beim Amtsgericht Leipzig: VR 783 | USt-IdNr. DE186551302